|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heinz Voigtlaender , Löhne und Preise in vier Jahrtausenden. Speyer 1994. S. 85ff Günther Hahn und Alfred Kendl haben in ihrem Buch "Friedrich der Große im Münzbild seiner Zeit" in akribischer Klein- und Feinarbeit Löhne und Preise aus der Regierungszeit dieses bedeutenden Preußenkönigs zusammengetragen, so daß man sich ein recht vollständiges Bild von der damaligen Zeit in Berlin machen kann. Sie bemerken dazu, daß die Preise trotz der drei Schlesischen Kriege erstaunlich wenig schwankten, was Menschen unserer Zeit kaum für möglich halten mögen, denn nach Beendigung des zweiten Weltkrieges ist nun eine ähnlich lange Zeit vergangen, wie die Regierungszeit Friedrich II., aber obwohl wir keinen Krieg hatten, an dem wir beteiligt gewesen wären, stiegen unsere Löhne und Preise geradezu raketenartig, so daß man das Won Inflation für diese Entwicklung leider nicht vermeiden kann. In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts galt in Berlin ein Reichstaler (14 Taler Fuß) = 24 gute Groschen zu 12 Pfennig =288 Pfennig. Der König galt als äußerst sparsam, und es ist bekannt, daß er beim Kauf bedeutender Gemälde meist dem König von Sachsen oder Katharina II. den Vortritt lassen mußte, weil er sich einschränken mußte. Er konnte aber auch großzügig sein - nur gar so oft kam das nicht vor. Einige Summen, die er zahlte, mögen das verdeutlichen: Für Watteaus Gemälde "Das Firmenschild des Kunsthändlers Gersaint" zahlte Friedrich im Jahr 1744 2.000 Taler. Antoine Pesne erhielt für sein Porträt der Tänzerin Barbarina nur 125 Taler. Voltaire war ihm als Gast bei freier Kost und Wohnung in seinem Palais blanke 5.ÖÜO Taler im Jahr wert. Für die Berliner Porzellanmanufaktur 1764 von Gotzkowsky zahlte er nur 225.000 Taler. Als Sammler seiner geliebten Tabatieren war er nicht kleinlich. Er zahlte 2.000 bis 10.000 Taler pro Stück und hatte bei seinem Tod 130 Stück. Kurz vor dem Tode des Königs ließ man den damals berühmten Arzt Zimmermann aus Hannover nach Potsdam kommen. Dieser erhielt für die 14 Tage, die er um den sterbenden König bemüht war, 2.000 Taler. Ein preußischer Infanterist erhielt pro Monat 5 Taler 4 Groschen, wovon aber l Taler 5 Groschen für Kleidung und sonstige Unkosten einbehalten wurden. Fähnrich und Leutnant erhielten 11 und 14 Taler pro Monat unter Einbehaltung von 3 und 4 Talem. Bei der Kavallerie lagen die Bezüge etwas höher, aber dafür mußten die Pferde zusätzlich versorgt werden. Ein Korporal erhielt im Monat 4 Taler, ein Wachtmeister 6, ein Leutnant 24 und ein Rittmeister 90 Taler. Ein Generalleutnant kam auf etwa 4.000 Taler und ein Generalfeldmarschall brachte es auf 10 - 12.000 Taler. Da Preußen zu dieser Zeit keine qualifizierten Militärärzte hatte, erhielt der angeworbene französische Militärarzt Maitre 1.000 Taler, während die Deutschen nur 100 Taler bekamen. Für die Eroberung einer Kanone waren 100 Dukaten ausgesetzt, für die einer Fahne 4 Dukaten. Anspruch auf Pension bestand nicht. Wer nicht im Invalidenhaus unterkam, erhielt monatlich einen "Invalidentaler". Ein Minister hatte ein Jahresgehalt von 4.000 Taler. Maupertuis erhielt als Präsident der Akademie der Wissenschaften im Jahr 3.000 Taler. Winkelmann forderte 1765 für die Betreuung der königlichen Bibliothek und des Münz- und Altertümerkabinetts jährlich 2.000 Taler, erhielt sie nicht und nahm den Posten nicht an. Dagegen erhielt die Tänzerin Barbarina jährlich 5.000 Taler, die dann sogar auf 7.000 Taler anstiegen. Für den Druck einschließlich Kupferstiche des l. Bandes von Friedrichs Werk "Oeuvres du Philosoph de Sanssouci" (1749) erhielt Schmidt 1.086 Taler und 18 Groschen. Im Grauen Kloster in Berlin (Gymnasium) erhielt ein Lehrer 20, ein Konrektor 48 und der Rektor 135 Taler. ein Schneider-, Maurer- oder Zimmergeselle verdiente in Berlin 8-9 Taler. Ein Kutscher erhielt bei freier Unterkunft und Kost 12 - 16 Taler. Ein Diener kam auf 10-12 Taler, eine Köchin erhielt 8-18 Taler und ein Kostgeld von 21-24 Groschen; ein Dienstmädchen 8-16 und 12 Groschen, eine Amme 12-20 Taler und ein Kindermädchen 6 Taler. Für Spareinlagen über 50 Taler erhielt man 2,5 %. Die Leihgebühr betrug 5 %. Die Mieten betrugen in Berlin etwa 7 % des Haus- und Grundstückswertes. Die Übemachtungspreise in einem Berliner Hotel der l. Klasse lagen zwischen 10 Groschen und 2 Talern; ein Mittagessen mit 5 Gängen kostete 16 Groschen, ein Abendessen mit 3 Gängen nebst Butter und Käse 12 Groschen und ein Butterbrot mit Braten l Groschen 6 Pfennige. In einem Hotel der 2. Klasse zahlte man für l Zimmer 8-10 Groschen. Ein Mittagessen mit 3 Gängen nebst Butter kostete 6 Groschen und mit Dessert 8 Groschen. In einem Hotel der 3. Klasse kostete das Zimmer 6 Groschen und das Mittagessen 3 Groschen. In den Berliner Restaurants lagen die Preise für ein Mittagessen zwischen 3 - 12 Groschen. Ein gebratenes junges Huhn mit Gurkensalat kostete 8 Groschen. 1740 stieg der Preis für l Scheffel (etwa 40 kg) Roggen in Berlin wegen einer Mißernte bis auf l Taler 21 Groschen. Danach kostete er bis zum Siebenjährigen Krieg 19-20 Groschen. Im "Hungerjahr" 1771 stieg der Roggenpreis sogar auf über 2 Taler an. Etwa 1740 bekam man einen Hirsch oder ein starkes Wildschwein für 4 Taler 12 Groschen frei Haus geliefert. 1780 kostete in Spandau ein "großer Aal" 12 Groschen und 9 Kiebitzeier 4 Groschen. Für Rock und Weste guter Normalqualität zahlte ein Handwerksgeselle 12 Taler, der wohlhabende Bürger aber gab dafür etwa 50 Taler aus. Bei einer Hose mit den passenden Strümpfen lag die Differenz zwischen 3 und 12 Talern. Ein Paar Stiefel kostete für beide 6-7 Taler und Schuhe 1-2 Taler. Eine Perücke kostete 2 Taler und ein Spiegel im Format 20 x 25 cm 22 Groschen. Ein großer Spiegel im Format 95 x 150 cm kam auf etwa 312 Taler! |
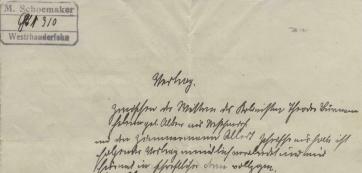 |
||||||
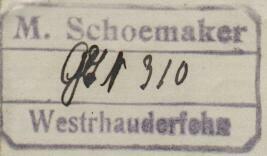 |
||||||
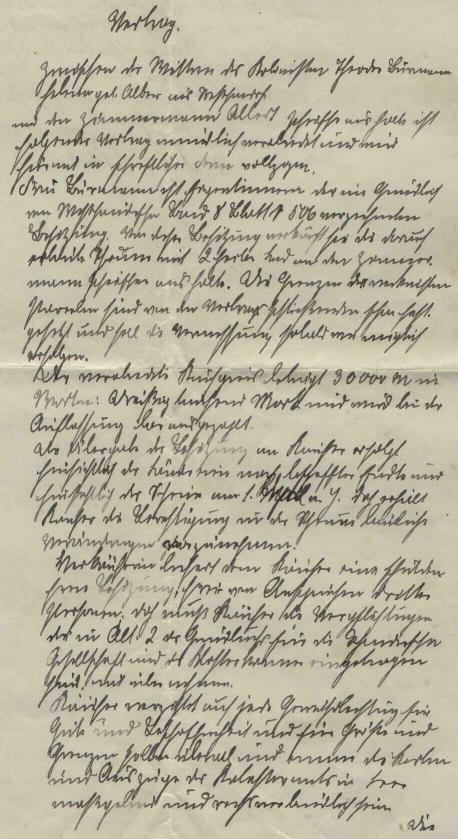 |
||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Westrhauderfehn. Als im Dezember 1895 die Gebrüder Lumiere auf einer Leinwand im Grand Cafe in Paris erstmals einen Zug fahren ließen, brach im Publikum noch Panik aus. Der Siegeszug des Kinos war dadurch aber nicht aufzuhalten. Schon 1913 wurde im Overledingerland das erste Filmtheater eröffnet. Es war Jelly Bahns, Inhaber des Hotels "Frisia" im Untenende von Westrhauderfehn, der es vielen Menschen ermöglichte, Asta Nielsen in "Abgründe" und andere Produktionen der deutschen Traumfabrik zu bewundern. Der Kino-Pionier vom Fehn sorgte seinerzeit auch für die musikalische Unterhaltung des Publikums. Denn als die Bilder laufen lernten, waren die Leinwandhelden noch stumm. Jelly Bahns spielte deshalb während der Filmvorführungen auf dem Klavier. 1933 starb er. Sein Enkel Joachim Bahns aus Rhaudermoor erinnert sich, daß das Hotel (Foto) von Fritz Bahns und seiner Frau Gerda übernommen wurde. Damals gehörten zu dem Unternehmen die Gaststätte mit Kegelbahn, das Hotel und das Kino. Mitte der 50er Jahre wurde das Hotel "Frisia" von Gerhard Nanninga gekauft. (GA v. 2.6.2001) |
|
|
 |